



Der Strategiekongress richtet sich im Besonderen an Fach- und Führungskräfte in Kirche und kirchennahen Organisationen, die mit Spannungen, Bruchlinien und widersprüchlichen Erwartungen im Alltag und in Veränderungsprozessen umgehen.
Die Kongressreihe „Strategie und Entwicklung in Kirche und Gesellschaft“ existiert seit 2008. Träger des Strategiekongresses ist der Verein futur2 e.V., der die gleichnamige Online-Zeitschrift herausgibt. Der 9. Strategiekongress wird vorbereitet von Henriette Crüwell, Dr. Valentin Dessoy, Birgit Dierks, Ursula Hahmann, Dr. Tobias Kläden, Frank Reintgen, Andreas Schlamm und Judith Uebing.
Der Strategiekongress startet am 2. Dezember um 9:30 Uhr.
Der erste Kongresstag nimmt Fragmentierung und Polarisierung in der Gesellschaft aus empirisch-wissenschaftlicher, soziologischer und psychologischer Perspektive in den Blick. Die Impulse dienen dabei nicht nur der Information, sondern sind bewusst mit Phasen der Reflexion in kleineren Formationen und mit Dialogen im Plenum verbunden. So werden wissenschaftliche Erkenntnisse mit eigenen Wahrnehmungen, Erfahrungen und Fragen der Teilnehmenden in Beziehung gesetzt. Im Anschluss richtet sich der Blick auf Praxisbeispiele. In Workshops zeigen unterschiedliche Akteur:innen, wie Polarisierung bearbeitet werden kann.
Der erste Kongresstag klingt mit einer gemeinsamen Abendgestaltung aus. Ein offenes Abendlob bietet Raum für Innehalten und Sammlung nach einem reichhaltigen Tag. Im Anschluss lädt ein Get-together dazu ein, Gespräche fortzusetzen, Eindrücke zu teilen und miteinander ins Gespräch zu kommen
Der zweite Kongresstag richtet den Blick auf Polarisierung in der Kirche. Im Zentrum stehen Erfahrungen, Spannungen und Konfliktlinien, die entstehen, wenn Auffassungen differieren und Grenzen gezogen werden. Ausgehend von persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen fragt der Tag danach, wie innerkirchliche Polarisierung entsteht, wie sie erlebt wird und unter welchen Bedingungen Dialog, Streit oder Abgrenzung konstruktiv gestaltet werden können.
Der Strategiekongress endet gegen 17 Uhr.
9. Strategiekongress: 2. und 3. Dezember 2026 im Kardinal-Schulte-Haus, Bensberg. Der Kongressbeitrag beträgt 490,- €.
Die Anmeldung erfolgt über unseren Mitveranstalter, der Thomas-Morus-Akademie. Bitte laden Sie das Anmeldeformular herunter und senden Sie es ausgefüllt an akademie@tma-bensberg.de
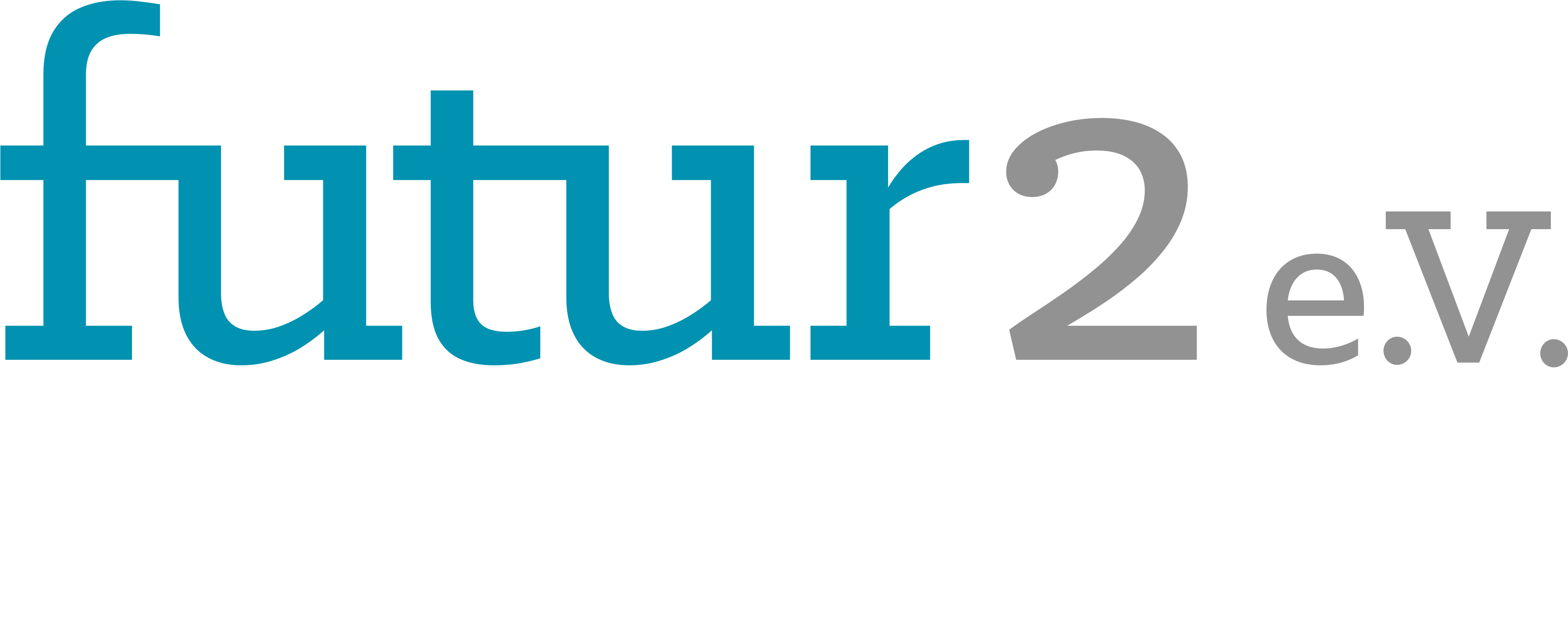
Die Kongressreihe Strategie und Entwicklung in Kirche und Gesellschaft existiert seit 2008. Träger des Strategiekongresses ist der Verein futur2 e.V., der die gleichnamige Online-Zeitschrift herausgibt.
Veranstalter des Kongresses sind kairos, Coaching, Consulting, Training Mainz, die Thomas-Morus-Akademie Bensberg und die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi) und die XIQIT GmbH.
Für Kongressplanung, Veranstaltungsdesign und Durchführung zeichnet sich das Board verantwortlich – ihm gehören aktuell an: Henriette Crüwell, Dr. Valentin Dessoy, Birgit Dierks, Dr. Tobias Kläden, Ursula Hahmann, Frank Reintgen, Andreas Schlamm und Judith Uebing.
Kontakt: info@strategiekongress.org
Foto: Kardinal Schulte Haus